Forschung zu Batterieanode auf Basis von Silizium und Zinnsulfid
Aktuell basieren Anoden in Lithium-Ionen-Batterien meist auf Graphit bzw. Kohlenstoff. Laut dem MoSiLIB-Projektteam besteht bei Naturgraphit jedoch ein Versorgungsrisiko und die herkömmlichen kohlenstoffbasierten Anoden stoßen überdies an ihre Kapazitätsgrenze, „was neue Materialkonzepte erfordert, um den steigenden Anforderungen an Energiespeicherung gerecht zu werden“. Das vom AIT geleitete Forschungsprojekt setzt genau hier an: Ziel sei es, „die Nachteile bisheriger Anodenmaterialien zu umgehen, die Nutzung von kritischen Rohstoffen zu reduzieren und gleichzeitig die Batterieleistung sowie die Zyklenstabilität signifikant zu verbessern“, wie es in einer begleitenden Mitteilung heißt.
Im Zentrum des Forschungsprojekts steht eine Kompositanode auf Basis von Silizium und Zinnsulfid (SnS2). Durch die chemische Interaktion von SnS2 mit Silizium entstehen dem Projektteam zufolge Si/Li2S- und Sn/Li2S-Heterostrukturen, die die Volumenausdehnung der Anodenpartikel abpuffern und die Agglomeration während der Ladezyklen reduzieren. Dadurch werde die Lebensdauer der Batterie erhöht, was die Kompositanode für Lithium-Ionen-Batterien (der Generation 3b) mit LNMO-Kathoden besonders geeignet machen soll. LNMO steht für Lithium-Nickel-Manganoxid.
Angestrebt wird vom Projektkonsortium, dass die Kompositanode auf Basis von Silizium und Zinnsulfid eine reversible Kapazität von 800 mAh/g über mehr als 1000 Zyklen erreicht. Dazu experimentiert das Team nicht nur mit dem Material selbst, sondern auch mit der Materialverarbeitung (etwa in Form einer Kombination aus Sprühtrocknung und Hochenergie-Kugelmahlen). Die daraus resultierenden Anodenmaterialien wollen die Initiatoren in vollständigen Zellen mit LNMO-Kathoden testen, im Einzelnen in Knopf- und Pouchzellen (inklusive mehrlagiger Pouchzellen).
Ergänzend zur experimentellen Forschung setzt MoSiLIB auf eine Modellierung, um die neuen Anodenmaterialien leistungsfähiger zu machen und Alterungsmechanismen detailliert zu verstehen. Und: Neben der Materialentwicklung liegt ein weiterer Schwerpunkt des Projekts auf der semi-industriellen Skalierung der Syntheseprozesse sowie der wasserbasierten Elektrodenfertigung, um eine nachhaltige und wirtschaftliche Produktion sicherzustellen. Außerdem soll hochreines Silizium verwendet werden, das zuvor aus ausgedienten Solarmodulen recycelt wird.
Neben dem AIT Austrian Institute of Technology gehören dem Projektkonsortium folgende Akteure an: die Universität Wien, die AVL List GmbH, die Frimeco Produktions GmbH, die Université de Liège / Greenmat und die Universität Ljubljana. Finanziert wird das Projekt von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG).
„Mit MoSiLIB gehen wir einen entscheidenden Schritt in Richtung nachhaltiger und leistungsfähiger Lithium-Ionen-Batterien“, kommentiert AIT-Forscher Damian Cupid, der das Projekt leitet. „Indem wir innovative Materialien und umweltfreundliche Herstellungsverfahren kombinieren, können wir nicht nur die Effizienz von Batterien verbessern, sondern auch deren ökologische Auswirkungen verringern. Dies ist ein wesentlicher Beitrag für die Energiespeicherung der Zukunft und die weitere Entwicklung der Elektromobilität.“



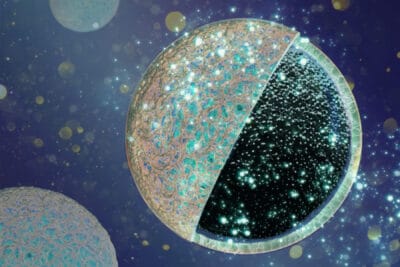


0 Kommentare