Brennstoffzelle: Fraunhofer ISE feilt an skalierbarer MEA-Produktion
Das Fraunhofer ISE zielte bei seiner Plattform-Entwicklung auf innovative und kontinuierliche Prozesse zum Bau von Membran-Elektroden-Einheiten. Denn nur durch hohe Durchsatzraten sind künftig Kostensenkungen bei der Herstellung der Kernkomponente für Brennstoffzellen möglich. Die Produktionsforschung der Fraunhofer-Einrichtung berücksichtigt dabei die gesamte Wertschöpfungskette – einschließlich der Qualitätskontrolle.
Zur Einordnung: MEA sind das Herzstück jeder Polymer-Elektrolyt-Membran (PEM)-Brennstoffzelle, in dem die Umwandlung von chemischer zu elektrischer Energie stattfindet. Aus Sicht des Fraunhofer ISE wird eine beschleunigte und automatisierte Produktion dieser Komponente immer wichtiger. Denn: „Getrieben durch die Forderungen nach einem emissionsfreien Schwer- und Nutzlastverkehr investieren Lkw-Hersteller derzeit stark in Antriebe mit Brennstoffzellen“, so das Projektteam. „Das erwartete Produktionsvolumen für 20.000 Lkw liegt bei 1,2 Millionen Quadratmeter aktiver MEA-Fläche jährlich.“ Diese Menge ergibt sich aus angenommenen 30 m² Membran- und 60 m² Katalysatorschicht pro Fahrzeug.
Für den Elektrolyse-Hochlauf werden laut den Verantwortlichen pro Gigawatt Zubau wiederum 25.000 bis 35.000 Quadratmeter katalysatorbeschichtete Membran benötigt. „Diese Mengen sind mit heutigen Herstellungsverfahren jedoch nicht erreichbar. Für den erwarteten Markthochlauf müssen bestehende Anlagenkonzepte angepasst und skalierungsfähige Produktionsmethoden entwickelt werden“, skizzieren die Forscher die aktuelle Lage.
Die Produktionsforschung am Fraunhofer ISE betrachtet deshalb jeden Fertigungsschritt intensiv – von der Behandlung des Katalysatorpulvers bis hin zur Zusammensetzung der 7-Lagen-MEA, die aus einer zentralen Membran und je zwei Katalysatorschichten, Verstärkungsrahmen und Gasdiffusionslagen besteht. Untersucht werden dabei die Einflüsse von Prozessdesign und -parametern, Materialien und Komponentenarchitektur auf Kosten, Qualität und Leistung der MEA.
Gleich zu Beginn der Wertschöpfungskette untersuchen die Fraunhofer-Wissenschaftler etwa verschiedene Mischverfahren zur Herstellung von Katalysator-Tinten. Im weiteren Verlauf feilen sie u.a. an der Membranbeschichtung, der Trocknung der Katalysatorschicht und dem Verstärkungsrahmen. Als einen zentralen Prozessschritt bezeichnet das Fraunhofer-Institut die Herstellung der Katalysatorschichten, die entweder auf eine Transferfolie oder direkt auf die Membran aufgedruckt werden. Neben dem bewährten Schlitzdüsenverfahren können seine Forscher dank austauschbarer Druckeinheiten neuerdings auch Rotationsdruckverfahren oder indirekten Tiefdruck erproben.
Oberstes Ziel ist und bleibt dabei die notwendige Skalierbarkeit. Daher setzt das Fraunhofer ISE allen voran auf kontinuierliche Rolle-zu Rolle-Prozesse. Angestrebt wird konkret eine Durchlaufgeschwindigkeit von 10 Metern pro Minute – ein Wert, mit dem die Industrie gut umgehen könne, so die Initiatoren.
Die komplette Produktionskette wird in industrienahen Pilotanlagen im Wasserstoff-Technikum des Fraunhofer ISE erprobt. „Wir sind das weltweit einzige Forschungsinstitut, das Produktionsanlagen in industriellem Maßstab inklusive Mikrostrukturanalyse und Charakterisierung von MEAs im Teststand zur Verfügung hat, was einen schnellen Transfer aus dem Labor in die Fertigung erlaubt“, kommentiert Ulf Groos, Abteilungsleiter Brennstoffzelle am Fraunhofer ISE. Neben der Produktionsforschung für Brennstoffzellen-MEAs könne die Pilotanlagen auch für die Elektrolyse-MEAs (Protonen-Austausch-Membran und Anionen-Austausch-Membran) genutzt werden.
In die Anlage integrierte Messtechnologien sorgen obendrein für eine inline Qualitätskontrolle. „Trotz des durchlaufenden Prozesses können wir Veränderungen im Produktionsprozess und deren Auswirkungen auf spätere Prozessschritte oder die Produktqualität nachvollziehen. Wir nutzen dafür ein Track & Trace-System, das regelmäßig Markierungen an den Produkten setzt“, erläutert Projektleiterin Linda Ney vom Fraunhofer ISE. Die auf der Pilotanlage prozessierten MEAs werden zudem in Brennstoffzellen unter variierenden Betriebsbedingungen auf ihre Performance hin getestet.
ise.fraunhofer.de





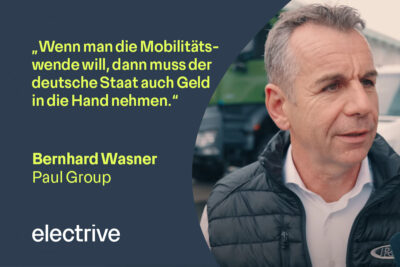
3 Kommentare