
Nissan Interstar-e: Souveräner E-Transporter mit Abstrichen
Über seine Allianz mit Renault hat Nissan den Interstar im vergangenen Jahr erstmals auch mit Elektroantrieb in den Handel gebracht. Der E-Transporter steht dabei auf derselben Plattform wie die vierte Generation des Renault Master E-Tech. Optisch unterscheidet sich der Elektro-Interstar kaum vom Verbrenner-Pendant. Er übernimmt damit aber auch die Eigenschaften des Kollegen.
Unabhängig vom Antrieb heißt das zusammengefasst: Im Vergleich zu seinem (Verbrenner-)Vorgänger bietet der neue Nissan-Transporter größere Abmessungen und eine verbesserte Aerodynamik. Laut Hersteller wurde der Luftwiderstand um rund 20 Prozent reduziert – erzielt unter anderem durch eine stärker geneigte Windschutzscheibe und die nach hinten abfallende Dachlinie. Außerdem hat Nissan die Individualisierungsmöglichkeiten erweitert: Ab Werk sind nun zahlreiche Umbauten verfügbar, darunter Kipper, Pritschen und der klassische Kastenwagen. Letztere Variante verfügt nun über eine vier Zentimeter breitere Seitentür und eine zehn Zentimeter längere Ladefläche. In Summe wächst die Fahrzeuglänge damit um 13,7 Zentimeter, während die Breite nur leicht zunimmt und die Höhe unverändert bleibt. Der Radstand verkürzt sich dagegen um knapp zehn Zentimeter.
Für den Fahrbericht stand uns der Interstar-e in der Kastenwagen-Variante L2H2 zur Verfügung. Alternativ bietet Nissan das Modell auch als L3H2 an. Während der Diesel-Ableger zusätzlich noch als L3H3 erhältlich ist, entfällt diese Option beim elektrischen Pendant. Egal, für welche Variante sich letztlich entschieden wird, an den Abmessungen in der Fahrerkabine ändert sich dadurch nichts.
Innenraum auf Pkw-Niveau
Schon beim Einsteigen fällt auf, dass Nissan Wert auf Übersichtlichkeit und Ergonomie legt. Dass ein Transporter eher auf Praxistauglichkeit als auf Komfort getrimmt wird, versteht sich von selbst. Doch Nissan hat es geschafft, das Cockpit des Interstar-e auf einen Komfort zu bringen, wie man ihn sonst eher aus dem Pkw-Bereich kennt.
Eine detaillierte Konfiguration der Sitze wie bei Mercedes-Benz im Sprinter bieten die Japaner zwar nicht, dennoch sitzt es sich in den ab Werk verbauten Sitzen überraschend bequem – auch auf längeren Touren. Hinter dem in Höhe und Tiefe verstellbaren Lenkrad blickt der Fahrer auf eine übersichtlich gestaltete digitale Instrumententafel. Rechts davon befindet sich ein leicht zum Fahrer geneigter Touchscreen. Wie vom Renault Master bekannt, arbeitet darunter ein auf Android basierendes Betriebssystem. Auf Wunsch kann man sich per Android Auto oder Apple CarPlay (auch kabellos) mit dem Infotainmentsystem verbinden. Praktisch, aber auch notwendig zugleich, denn über ein eigenes Navigationssystem verfügt der Interstar bislang nicht. Dieses soll inkl. Nissan Connected Services erst im Sommer 2026 eingeführt werden, wie Nissan gegenüber electrive mitgeteilt hat.














Die Klimaanlage wird hingegen noch klassisch über drei große Drehregler bedient. Aus meiner Sicht in Ordnung. Irritierender ist, dass der elektrische Interstar noch mit einem Zündschloss daherkommt und ausschließlich darüber gestartet wird. Die Fahrstufenwahl erfolgt über einen Lenkstockhebel. Nissan stellt die Wahl zwischen dem normalen Vorwärtsgang oder einem sogenannten „Brake“-Modus, bei dem eine stärkere Rekuperation bei Wegnahme vom Strompedal eingestellt wird. One-Pedal-Driving gibt es im Nissan-Stromer aber nicht. Schade. Und bevor es losgehen kann, muss noch die nostalgisch wirkende manuelle Handbremse gelöst werden.
Ausreichende Leistung, hoher Fahrkomfort
Unter der Motorhaube des Testwagens arbeitet ein 105 kW starker Elektromotor, der ein maximales Drehmoment von 300 Nm liefert. Auf dem Papier klingt das für diese Fahrzeugklasse zwar nicht nach viel, während des Tests zeigte sich die Leistung aber als ausreichend. Die Diesel-Ableger lässt der Interstar-e beim Anfahren deutlich hinter sich. Schleppender geht es erst oberhalb von 100 km/h zu. Spätestens bei der abgeriegelten Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h ziehen allerdings die Verbrennerkollegen davon – die schaffen bis zu 177 km/h.
Die Stärken spielt der Interstar-e dafür beim Fahrkomfort aus. Dank des E-Antriebs bleiben Vibrationen wie beim Verbrennungsmotor ebenso aus wie ruckartige Bewegungen durch wegfallende Schaltvorgänge. Auch die deutlich geringere Geräuschkulisse im Innenraum trägt zum entspannteren Fahren bei. Das Fahrwerk ist recht komfortabel abgestimmt. Vor allem die Vorderachse dämpft – im Gegensatz zur Hinterachse – Schlaglöcher gut weg. Die direkte Lenkung und der um 1,5 Meter verkleinerte Wendekreis, der dank des um fast zehn Zentimeter kleineren Radstands möglich wurde, tragen ihren Teil zum gut manövrierbaren E-Transporter bei.
Überdurchschnittlich hohe Reichweite
Bei der Reichweite setzt der Interstar-e ein klares Ausrufezeichen. Mit der im Testwagen verbauten 87-kWh-Batterie (netto) verspricht Nissan bis zu 410 Kilometer nach WLTP. Ein Wert, der in diesem Segment zu den Bestmarken gehört. Daneben gibt es eine Basisversion mit 40 kWh und 96 kW Motorleistung, die auf rund 175 Kilometer kommt. Ein Blick zur Konkurrenz zeigt: Die Stellantis-Modelle mit rund 110 kWh schaffen etwa 424 Kilometer, der Mercedes eSprinter kommt – je nach Batteriegröße (81 oder 113 kWh) – auf 310 bis 440 Kilometer, und selbst Fords E-Transit liegt mit seiner 89-kWh-Batterie bei „nur“ 402 Kilometern.
Auch im Test konnte der Interstar-e überzeugen: Bei Außentemperaturen von um die 20 Grad pendelte sich der Verbrauch zwischen 22 und 29 kWh/100 Kilometer ein. Daraus ergaben sich je nach Fahrprofil Reichweiten zwischen 400 und rund 300 Kilometern. Wobei der höhere Wert hauptsächlich im Stadtbetrieb und bei optimalen Temperaturen zu erreichen ist. Besonders bemerkenswert war während des Testzeitraums eine Strecke von rund 260 Kilometern, von denen etwa 80 Prozent auf die Autobahn entfielen. Am Ende stand ein Verbrauch von 27,7 kWh/100 km auf der Uhr – bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 79 km/h. Dass die hohe Reichweite im Vergleich zum Wettbewerb nicht nur auf dem Papier besteht, zeigte sich damit auch in der Praxis.
Abzug in der B-Note beim Thema Laden
Irgendwann ist auch beim elektrischen Interstar die Batterie leer, dann heißt es: Ab an die Ladesäule. Positiv hervorzuheben ist das serienmäßige 22-kW-Onboard-Ladegerät, das Nissan für die Version mit großer Batterie anbietet. Damit dauert ein Ladevorgang rund 3,9 Stunden. Die kleine 40-kWh-Batterie muss sich hingegen mit einem 11-kW-Lader begnügen.
Tempo macht der Interstar-e nur am Schnelllader: Während die 40-kWh-Variante maximal 50 kW zieht, kann die große 87-kWh-Batterie mit bis zu 130 kW laden. Vorausgesetzt, sie hat die richtige Temperatur. Denn das Temperaturmanagement arbeitet nur halbherzig: Zwar ist die Batterie aktiv gekühlt, eine Heizung fehlt jedoch. Bei mehreren Schnellladevorgängen hintereinander kann die Ladeleistung reduziert werden. Und auch bei einer kalten Batterie geht es am Schnelllader langsamer zu. Für einen E-Transporter nicht unbedingt ein gravierender Einschnitt. Sollte es dennoch einmal auf große Tour gehen, sollte einem das allerdings klar sein. Inwiefern die Ladeleistung reduziert wird, konnte ich allerdings nicht testen.
Hat die Batterie dagegen ihre Wohlfühltemperatur erreicht, soll der Ladevorgang von 15 auf 80 Prozent rund 32 Minuten dauern. Diese Werksangabe bestätigte sich auch im Test. Für den gängigen Ladehub von zehn auf 80 Prozent stoppte ich 34 Minuten. Dabei legte der Interstar-e mit einem SoC (State of Charge) von neun Prozent direkt mit 125 kW los. Das Plateau von 130 kW erreichte er bei 24 Prozent und hielt es bis 45 Prozent, bevor die Leistung auf 94 kW fiel. Anschließend stieg sie vorübergehend noch einmal auf knapp unter 100 kW, ehe ein weiterer Leistungsabfall ab etwa 72 Prozent einsetzte.
Auch wenn ein Ford E-Transit mit 89 kWh von null auf 80 Prozent lediglich 28 Minuten benötigt. Verstecken muss sich der Interstar-e mit seiner Lade-Performance dennoch nicht. Er befindet sich damit im guten Mittelfeld. Und am Ende dürften ein paar Minuten Unterschied im Alltag kaum ins Gewicht fallen.
Zahlreiche Assistenten
Abseits von Reichweite und Ladeleistung zeigt sich der Interstar-e auch in puncto Ausstattung auf der Höhe der Zeit. So ist der Transporter unter anderem mit einem Fahrer- und Müdigkeitsassistenten, intelligentem Notbremsassistenten mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Seitenwindassistenten, Spurhalteassistent oder auch einer Geschwindigkeitserkennung – die im Vergleich zu den anderen Assistenten mehr schlecht als recht arbeitet und Schilder nicht immer richtig erkennt – ausgestattet. Das gilt übrigens auch für die Diesel-Version.
Der Interstar-e wird jedoch bereits mit der Ausstattungslinie N-Connecta ausgeliefert und bietet schon in der Basis mehr. Bedeutet: Die EV-Version hat zusätzlich ab Werk bereits das 10,1 Zoll große Touchdisplay, elektrische Fensterheber, Licht- und Regensensor, Nebelscheinwerfer, 12-V-Anschlüsse im Cockpit und Laderaum, Beifahrerdoppelsitzbank mit umklappbarer Rückenlehne, Fahrersitz „Komfort“ mit Lendenwirbelstütze, Verzurrösen im Laderaum oder auch eine Klimaautomatik mit an Bord. Besonders praktisch ist allerdings die Rückfahrkamera, die bei voller Beladung eine Sicht nach hinten ermöglicht.










Abstriche bei Nutz- und Anhängelast
Bei aller Technik darf man nicht vergessen: Am Ende zählt, was hineinpasst – und was hinten dran darf. Während der Diesel je nach Ausstattung als L2H2 eine Nutzlast von mindestens 1.096 und maximal 1.447 Kilogramm und als L3H2 von 1.050 bis 1.375 Kilogramm bietet, liegt der elektrische Interstar je nach Variante rund 200 (L2H2 893 kg, L3H2 822 kg) bis 400 Kilogramm (L2H2 1.045 kg, L3H2 965 kg) darunter. Je nach Einsatzzweck, Gewerk und Ausbau kann dieses Minus schnell ins Gewicht fallen, auch wenn beim Diesel der Tankinhalt (80 Liter) noch hinzukommt. Ein Beispiel aus der Praxis: Im Handwerk ist es nicht unüblich, beide Seiten des Laderaums mit einem Sortimo-System samt Bodenverkleidung auszurüsten. Allein das bringt rund 400 Kilogramm auf die Waage. Werkzeug und Verbrauchsmaterial kommen obendrauf – und schmälern die verbleibende Nutzlast schnell um mehrere Hundert Kilogramm weiter. Das sollte man zumindest im Hinterkopf haben.
Wem also eine Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts von 3,5 Tonnen drohen sollte, kann den Interstar mit der großen Batterie immerhin mit einer Auflastung auf vier Tonnen (kleine Batterie maximal 3,8 Tonnen) ordern. Um diese Variante des E-Transporters mit dem Führerschein der Klasse B in Deutschland aber auch fahren zu können, muss man diesen mindestens bereits seit zwei Jahren besitzen, eine Einweisung erhalten und über einen Eintrag im Führerschein verfügen.
Auch bei der Anhängelast müssen Abstriche gemacht werden. So kann der Diesel-Transporter bis zu 2,5 Tonnen ziehen, beim elektrischen Interstar sind es hingegen maximal zwei Tonnen. Keine Unterschiede gibt es dafür bei der Dachlast, die unabhängig von der Antriebsart jeweils bei 200 Kilogramm liegt. Auch das Ladevolumen ist mit 10,8 Kubikmetern (L2H2) und 13 Kubikmetern (L3H2) gleich.
Fazit
Wer mit den Abstrichen bei Nutz- und Anhängelast leben kann, findet im Interstar-e einen soliden E-Transporter, der sonst kaum Schwächen zeigt – vor allem nicht im Vergleich zum Diesel-Pendant. Nur beim Preis hapert es noch: Während der vergleichbare Diesel je nach Getriebe zwischen 39.890 und 42.390 Euro kostet, startet der Interstar-e mit großer Batterie bei 53.500 Euro, die kleine Batterie bei 46.200 Euro. Eine Bundesförderung gibt es derzeit nicht, die die Differenz zum größten Teil auffangen könnte. Lokale Förderprogramme auf Landes- oder gar Kreis-/Stadtebene für E-Fahrzeuge oder auch nur für die Ladeinfrastruktur gibt es vereinzelt allerdings noch. Und: Wie auch beim Verbrenner bietet Nissan Nachlässe für den Interstar-e an, die „abhängig von Kundengruppe, Verfügbarkeit und Ausstattung/Version“ sind. Damit wird der Interstar-e zwar nicht zum Sparangebot, rückt preislich aber zumindest etwas näher an den Diesel heran. Und letztlich gibt es da auch noch die laufenden Kosten, die betrachtet werden müssen.


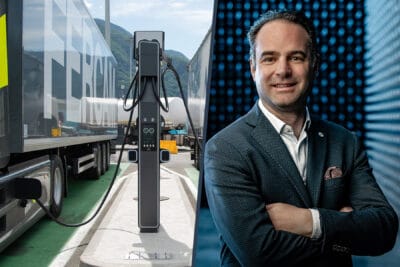


0 Kommentare