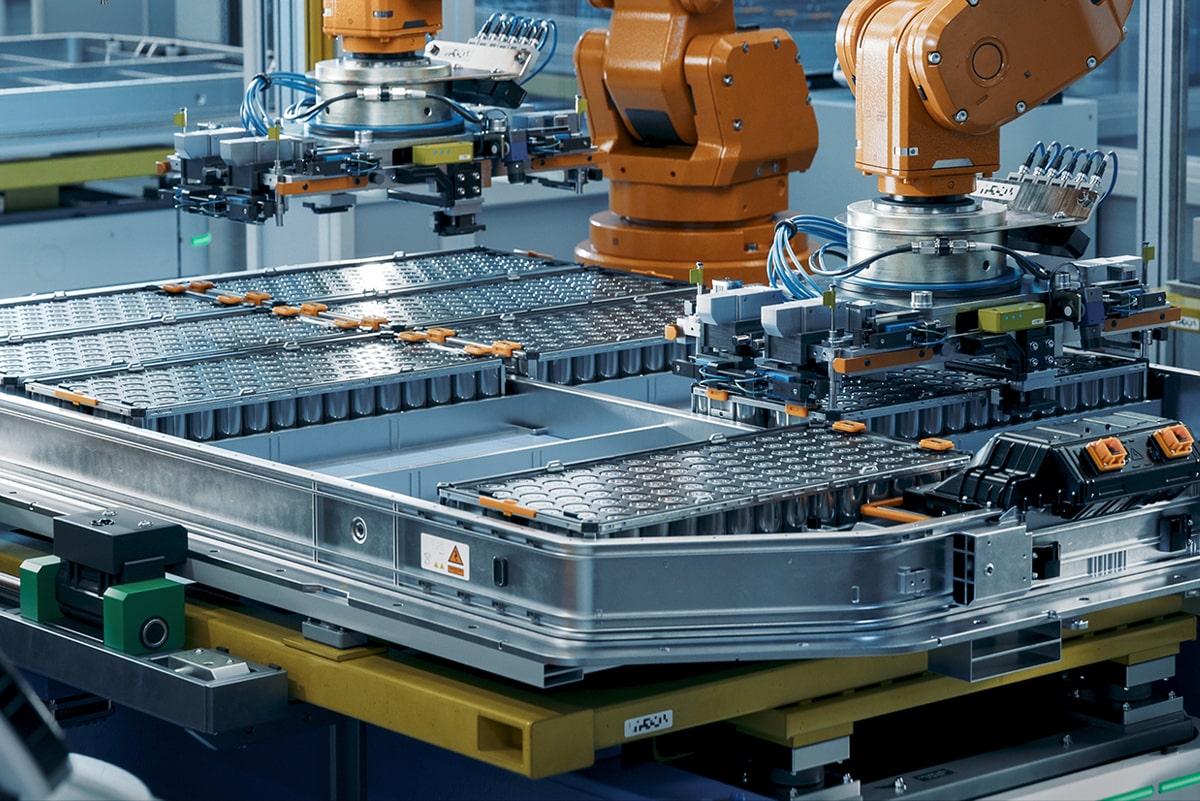
Neues Batterierecht – mehr Bürokratie für mehr Nachhaltigkeit
Mit dem am 7. Oktober in Kraft getretenen Batterierecht-EU-Anpassungsgesetz (Batt-EU-AnpG) hat der Gesetzgeber die EU-Batterieverordnung (EU) 2023/1542 (BattVO) in deutsches Recht umgesetzt. Letztere gilt bereits seit dem 28. August 2025 (mit wenigen Ausnahme-Regelungen) vollumfänglich und hat die zuvor auf EU-Ebene geltende Batterie-Richtlinie 2006/66/EG abgelöst.
Der wesentlichste Teil des Batt-EU-AnpG ist die Einführung des neuen Batteriedurchführungsgesetzes (BattDG), welches wiederum das bisher in Deutschland geltende Batteriegesetz (BattG) ablöst.
Gesamtpaket konkretisiert und ergänzt die aus der BattVO stammenden Pflichten der Wirtschaftsakteure
Wo viele Unternehmen zuletzt mehr Fokus, Planungssicherheit und industriepolitische Strategie gefordert haben – bekommen Sie nun zunächst mehr Regulierung. Doch Deutschland setzt damit um, was in Brüssel bereits vor Jahren mit der BattVO beschlossen wurde: Die BattVO gilt zwar unmittelbar, einzelne Inhalte bedürfen jedoch einer Konkretisierung in der nationalen Gesetzgebung. Auch wenn das neue Batterierecht darauf abzielt, den wachsenden Batteriemarkt über den gesamten Lebenszyklus von Batterien umweltfreundlicher, transparenter und sicherer zu gestalten: Das Ergebnis ist ein komplexes und selbst für Fachleute nur schwer verständliches Regelwerk verschiedener Vorschriften, das zwar hohe Ansprüche an Nachhaltigkeit stellt, gleichzeitig aber auch weitere Bürokratie für Unternehmen mit sich bringt.
Vom Umweltgesetz zum Bürokratie- und Datenprojekt
Die EU will mit der BattVO die Kreislaufwirtschaft unterstützen und regulieren: Batterien sollen länger halten, reparierbar sein und nach ihrem Lebensende möglichst vollständig recycelt werden. Das klingt vernünftig – die deutsche Umsetzung ist jedoch schwer verständlich und aktuell auch noch lückenhaft.
Zu ihr gehören neue Registrierungspflichten, behördliche Zuständigkeiten und umfangreiche Datenerhebungen. Hier eine Übersicht einzelner Kernpunkte:
- Die Stiftung „ear“ (elektro-altgeräte-register) wird zentrale Stelle für Herstellerregistrierungen, die Bundesländer übernehmen „nur“ noch Vollzugsaufgaben. Für viele Unternehmen bedeutet das: Sie müssen sich neu registrieren, obwohl sie nach dem alten BattG bereits registriert waren. Batteriehersteller mit Sitz außerhalb Deutschlands müssen bei der Stiftung ear einen Bevollmächtigten benennen, der einen Sitz in Deutschland hat.
- Hersteller können ihre batteriebezogenen Verantwortlichkeiten durch die Zusammenarbeit mit einer „Organisation für Herstellerverantwortung“ (OfH) wahrnehmen. Die OfH wiederum müssen zuvor eine Zulassung durch die Stiftung ear erhalten haben. Erleichterungen für Hersteller entstehen beispielsweise dadurch, dass nicht wie bisher jedes einzelne Unternehmen ein eigenes Rücknahmesystem für Altbatterien betreiben muss. Diese Aufgabe kann nun durch eine OfH für mehrere Hersteller kollektiv durchgeführt werden.
- Einen Eigenweg geht Deutschland mit der Einrichtung der sogenannten „Altbatteriekommission“, die teilweise als weitere bürokratische Hürde, teilweise aber auch als sinnvolles Konstrukt gesehen wird. Die Altbatteriekommission wird die zuständige Behörde bei verschiedensten Fragen zur Anwendung und Umsetzung der Vorschriften beraten, etwa bei der technischen Einordnung der Batterien in Kategorien oder bei Maßnahmen, die die Batteriesammlung verbessern sollen. Das Gremium besteht größtenteils aus Mitgliedern der Wirtschaft und des Verbraucherschutzes (u.a. Hersteller, Händler, kommunale Entsorger, Wirtschafts-, Umwelt- und Verbraucherverbände) und gibt diesen so eine Möglichkeit, auf das behördliche Handeln einzuwirken.
Bürokratische Realität
Was seitens der EU als Nachhaltigkeitsstrategie begann, wird in der nationalen Umsetzung und in der Praxis zu einem Bürokratieprojekt.
Hersteller müssen sich in neuen Registern eintragen, Meldeportale nutzen, Umweltberichte anlegen und Nachweise für jeden Produktionsschritt führen. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen stoßen damit an ihre Grenzen. Viele klagen über unklare Schnittstellen zwischen der EU-Verordnung und dem nationalen Vollzug.
So ist etwa noch offen, wie der Datenaustausch für den digitalen Batteriepass technisch abläuft oder welche Prüftiefe die Marktüberwachung verlangt. Während die EU-Kommission an Delegierten Rechtsakten arbeitet, laufen demgegenüber bereits konkrete Fristen.
Unternehmen stehen daher vor dem Risiko, in Systeme zu investieren, die sie später wieder anpassen müssen, wodurch sie wertvolle Kapazitäten für andere Aufgaben verlieren. Konkrete Auswirkungen hatte das zuletzt bei den nur wenige Wochen vor Inkrafttreten verschobenen Lieferkettensorgfaltspflichten für den Batteriesektor. Deren Beginn war über zwei Jahre für August 2025 vorgesehen, wurde aber kurzfristig auf August 2027 geändert. Die Pioniere der Branche hatten zu diesem Zeitpunkt längst Zeit, Kapazität und finanzielle Mittel in entsprechende Systeme und Prozesse investiert. Aufgrund des nun verschobenen Beginns ist dieser Einsatz zwar nicht verloren. Wettbewerber, die weniger Wert auf Compliance legen, konnten in der Zeit ihre Ressourcen jedoch anderweitig nutzen.
Kritik aus der Branche
Nicht nur, aber auch deshalb erntet die Vorgehensweise des europäischen sowie des deutschen Gesetzgebers in der Wirtschaft auch Kritik.
Verbände aus Industrie und Mobilitätswirtschaft begrüßen zwar die Grundrichtung des neuen Batterierechts, kritisieren aber den zeitlichen Druck und den administrativen Aufwand. Auch Batterie-Start-ups (z.B. im Bereich der industriellen Batteriespeicher) warnen, dass die Anforderungen zur CO₂-Bilanzierung und zu Lieferkettennachweisen kleine Unternehmen überfordern können und wenn überhaupt nur mit weiteren kostspieligen Tools umsetzbar sind.
Beispielhaft hierfür ist der digitale Batteriepass. Darin müssen für bestimmte Batterien relevante Informationen enthalten sein, die von der chemischen Zusammensetzung bis zum CO₂-Fußabdruck reichen. Das ist ein Meilenstein für Transparenz, aber auch ein massiver IT- und Datenaufwand. Viele Hersteller fragen sich derzeit, wie sie diese Daten entlang der Lieferkette überhaupt verlässlich erfassen sollen.
Bei dem gemäß der BattVO verpflichtenden CO₂-Fußabdruck für Batterien fehlt zudem noch eine praxisnahe Berechnungsmethode, die für alle betroffenen Unternehmen auch umsetzbar ist. Viele Unternehmen sehen hier noch große Unsicherheit – vor allem, weil Zulieferer aus Drittländern zumindest zum heutigen Zeitpunkt oft keine ausreichenden Daten liefern können.
Hinzu kommt: Über alldem schweben Bußgelder für Pflichtverstöße, z.B. bei fehlender Registrierung oder unvollständigen Datensätzen, die das BattDG nun konkretisiert.
Übergangsfristen
Das Batt-EU-AnpG gilt im Kern seit dem 7. Oktober 2025. Einzelne Regelungen, etwa zur Behördenzuständigkeit, treten am 1. Januar 2026 in Kraft. Die Vorschriften zur CO₂-Bilanz folgen am 1. Januar 2027, und zum 18. Februar 2027 endet die letzte Übergangsfrist der darüber „schwebenden“ BattVO, die bis auf wenige Ausnahmen bereits seit dem 18. August 2025 in fast allen Bereichen gilt. Für den digitalen Batteriepass gelten eigene Übergangsfristen bis 2028.
Diese Staffelung klingt zwar teilweise großzügig – in der Praxis ist sie knapp. Der Aufbau von Daten- und Reportingstrukturen, insbesondere für internationale Lieferketten, dauert oft Jahre.
Was Unternehmen jetzt tun sollten
Das neue Batterierecht bringt die Branche in Bewegung: hin zu mehr Verantwortung, aber auch zu mehr Regulierung. Marktteilnehmer, die frühzeitig Strukturen aufbauen und Datenprozesse professionalisieren, werden zwar einen ganzen Stoß an Hausaufgaben erledigen müssen, aber auch langfristig profitieren – nicht nur in rechtlicher, sondern auch in strategischer Hinsicht.
Unternehmen sollten daher nicht warten, bis die Marktaufsicht erstmals anklopft, sondern aktiv werden:
- Bestandsaufnahme als erste Pflicht: Fällt das eigene Unternehmen und seine Produkte in den Anwendungsbereich der BattVO und was folgt daraus gemäß BattVO und nationaler Umsetzungen konkret? Insbesondere bei Batteriekomponenten (z.B. Batteriemanagementsystemen oder anderen Batterieteilen) ist dies nicht immer einfach zu beantworten.
- Anschließend sollten die Pflichten geprüft sowie Verantwortlichkeiten und Registrierungen geklärt werden. Die unternehmensinternen Prozesse und Managementsysteme müssen darauf abgestimmt und fortlaufend aktualisiert bzw. weitergeführt werden.
- Besonders wichtig ist es, relevante Vereinbarungen mit Lieferanten abzustimmen und abzuschließen: Nur wenn auch sie die entsprechenden Daten und Konformität liefern, können betroffene Wirtschaftsakteure ihre Pflichten erfüllen. Verträge sollten daher geprüft und gegebenenfalls angepasst werden – inklusive klarer Pflichten sowie Haftungsregelungen für fehlerhafte oder fehlende Angaben.






0 Kommentare