
Wie bidirektionales Laden in den Alltag kommen kann – Sechs Fragen an Johanna Bronisch von UnternehmerTUM
Pilotprojekte haben schon mehrfach bewiesen, welche Vorteile das bidirektionale Laden von Elektroautos hat. Für den einzelnen Kunden können sich nennenswerte Einsparungen oder gar Einkünfte ergeben. Und für die Energieversorger und Netzbetreiber ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten, wenn viele Elektroautos nicht nur intelligent gesteuert, sondern sogar als Energiequelle für das Netz genutzt werden können.
Trotz dieser Vorteile ist es bisher bei solchen Pilotprojekten geblieben. Zwar gab es an einzelnen Stellen Vorstöße aus der Industrie, die Produkte sind aber noch so teuer, dass sich diese Investition kaum rechnet. Wie kann also das bidirektionale Laden zum Durchbruch gebracht werden? Und braucht es vielleicht frische Ideen von Startups, die außerhalb von Großkonzernen vorangetrieben werden?
Vor der Fachkonferenz „Vehicle2Grid“, die Anfang April stattfindet, haben wir uns mit Johanna Bronisch, Head of Energy Innovation bei UnternehmerTUM zu genau diesen Themen unterhalten. An Europas größtem Gründungs- und Innovationszentrum arbeitet sie am Aufbau des sektorübergreifenden Ökosystems und leitet UnternehmerTUMs Kooperationsplattform für Unternehmen an der Schnittstelle von Energie- und Verkehrssektor.
Frau Bronisch, bidirektionales Laden und intelligentes Laden gelten als potenzielle Game Changer für die Elektromobilität: Das Elektroauto wird Teil des Stromnetzes und kann sogar Geld verdienen, während es geladen wird. Gleichzeitig gewinnen die Netzbetreiber, weil sie mit smart gesteuerten Ladevorgängen ihr Netz entlasten können. Und dennoch ist der große Durchbruch bisher ausgeblieben. Woran liegt das?
Ich denke, man kann hier zwei Themen trennen: Bidirektionales Laden und intelligentes Laden. Letzteres muss nicht unbedingt bidirektional sein und kann trotzdem Mehrwerte für Nutzer und Netzbetreiber generieren.
Beim bidirektionalen Laden sind heute sicherlich mangelnde Anreize für Endkunden, fehlende bzw. heterogene technische Standards und die schlechte Verfügbarkeit interoperabler und erschwinglicher Hardware zentrale Hindernisse für die erfolgreiche Einführung von V2G. Darüber Hinaus brauchen wir dringend eine harmonisierte und kundenzentrierte Prozesse für den Datenaustausch zwischen den verschiedenen Systemen. Die Coalition of the Willing des BMWK engagiert sich hier bereits seit über einem Jahr sehr stark, um diese Hürden nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa zu überwinden. Jedoch würde ich mir noch breiter aufgestellte Unterstützung aus der Politik wünschen!
Beim intelligenten Laden sind die Hürden nicht ganz so vielseitig, umso schlimmer, dass wir das noch nicht hinbekommen. Die Antwort auf die Frage, warum es heute noch keine Anreize für Endkunden gibt, sich netzdienlich zu verhalten, hat eine einfache Antwort: Die Transportkosten des Stroms werden heute als statisches Entgelt im Strompreis abgebildet, wobei die lokale Auslastung u.a. mangels Beobachtbarkeit nicht abgebildet wird. Ob im Netz vor Ort gerade ein Engpass vorliegt und zusätzliche Abnahme sogar eine Grenzwertverletzung verursachen würde oder ob zusätzliche Abnahmen das Netz aufgrund hoher EE Erzeugung sogar entlastet, ist den Kunden also gänzlich unbekannt. Das müssen wir dringend ändern.
Genau daran arbeiten wir in einem industrie-finanzierten Co-Innovationsprojekt Grids & Benefits, das auch unter der Schirmherrschaft der Coalition of the Willing für V2G steht. Dort arbeiten wir gerade mit den Unternehmen Bayernwerk, BMW, EWE Netz, LEW, Maingau, Octopus Energy, TenneT, The Mobility House, TransnetBW und der RWTH Aachen an der Konzeptionierung für netzdienliche Anreize arbeiten.
Vehicle-to-Grid als Schnittstelle von Energie- und Mobilitätssektor bietet viel Potenzial, um sich als Startup mit einer eigenen Geschäftsidee zu positionieren. Bei UnternehmerTUM, dem Gründungs- und Innovationszentrum der TU München, arbeiten sie als Head of Energy Innovation gemeinsam mit Corporate- und Start-up Partnern genau an dieser Schnittstelle. Was sind aus Ihrer Sicht gerade die interessantesten Ansätze?
Das genannte Projekt, an dem sich The Mobility House und Octopus Energy beteiligen, gibt hier spannende Einblicke. Ich denke, der Fokus muss unbedingt auf der Kundenzentriertheit der Produkte liegen: je einfacher anwendbar und in den Alltag integrierbar, desto besser.
Gerade wenn es nicht mehr um die Early Adopter geht, sondern um gewöhnliche Autofahrer, für die ein dynamischer Stromvertrag nicht den Spannungsgehalt eines Blockbusters hat, oder die nicht wie Daniel Düsentrieb mit größter Freude verschiedene Hardwarekomponenten verdrahten möchten, dann müssen Produkte und Hardware einfach gestaltet sein. Ich denke nicht, dass wir in Deutschland irgendwann 80 Millionen Strommarktexperten haben. Das heißt: Produkte, die Kosteneinsparung bei begrenztem Risiko und ohne Komforteinbuße ermöglichen, werden hier erfolgreich sein. Außerdem sollten erforderliche Verhaltensänderungen möglichst leicht zu verarbeiten sein, wie z.B. Maximierung der Ansteckzeit.
Das Prinzip und die Vorteile von bidirektionalem Laden sind schnell und einfach erklärt, die praktische Umsetzung ist mit unzähligen Vorschriften und speziellen Anforderungen der Auto- und Energiebranche unglaublich komplex. Bremst das Innovationen in diesem Bereich?
Ich bin hier zwiegespalten. Es bremst sicherlich die Geschwindigkeit, mit der junge Unternehmen neue Geschäftsmodelle entwickeln und vor allem iterieren können, das heißt in schnellen Feedbackschlaufen anpassen und verbessern können. Gerade wenn es um Konzepte für Endkunden geht, wie die Integration von V2G in meinen Alltag, müsste ich schnell und pragmatisch verschiedene Ansätze ausprobieren. Aufgrund der hohen regulatorischen Hürden ist das in der Tat nicht einfach, ist natürlich aber auch in der Systemrelevanz und Komplexität des Stromsystems gut begründet. Beim Thema Smart Meter, einem der größten Roadblocks für viele neue Geschäftsmodelle, denke ich aber, wir könnten uns mehr am Vorgehen unserer Europäischen Nachbarn orientieren. Hier müssen wir schneller werden. Außerdem halten wir regulatorische Testräume für extrem wichtig und würden uns hier noch mehr Unterstützung wünschen, sowohl von der Politik als auch von der Regulierungsbehörde.
Bisher hat sich in der Autobranche noch nicht einmal durchgesetzt, ob bidirektionales Laden besser über Wechselstrom oder doch über Gleichstrom erfolgen soll. Welcher Spielraum ergibt sich für Startups, wenn solche Grundlagen-Entscheidungen in der Branche noch nicht einmal definiert sind? Oder ist die Gefahr groß, aufs falsche Pferd zu setzen?
Natürlich trifft letzteres zu, aber ich denke, es ist auch Kern des Gründergeistes mit solcher Unsicherheit umgehen zu können. Aus der Unsicherheit können sich nämlich auch Chancen ergeben: Ich kann mich z.B. gezielt auf das bidirektionale Laden zu Hause konzentrieren, eine Systemlandschaft in der AC dominieren, mein technisches USP ausbauen und auf starke Partnerschaften in diesem Ökosystem setzen. Alternativ kann ich auch gerade die Offenheit gegenüber beiden Ansätzen zum Markenkern machen und mich so differenzieren.
Auf der Fachtagung Vehicle to Grid Anfang April in Aachen sind Sie Host der Session zur Systemintegration. Dass die Fahrzeuge an sich und isolierte Systeme funktionieren, haben Praxis-Tests zuhauf belegt. Kommt es also jetzt auf eben jene Systemintegration an, um die Fahrzeug- und die Energiewelt wirklich intelligent zu verbinden?
Das kann man so sagen. Ich freu mich sehr auf die hervorragend besetzte Session, in der insbesondere auch internationale Perspektiven vertreten sind, von denen wir sicherlich viel lernen können. Das Spannende ist nicht nur das Zusammenführen der Systeme, das heißt ein EU-weites, hochkomplexes, fein ausgesteuertes Stromnetz mit einer, aus Millionen von Einzelassets bestehenden EV-Flotte, sondern auch das Zusammenführen der Branchen: Hier treffen unterschiedliche Welten aufeinander. Genau deshalb ist auch die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit in diesem Bereich so gewinnbringend: Die Systemintegration muss zuallererst auf der Ebene der Menschen stattfinden. Dafür muss Raum für konstruktiven und zielführenden Austausch sowie Testräume für Verprobung geschaffen werden. Das machen wir im Kleinen in unseren Projekten, aber natürlich auch andere, wie die FfE mit ihren wegweisenden Konsortien wie BDL und BDL Next oder die Coalition of the Willing des BMWK. Mal sehen welche Möglichkeiten sich aus der V2G Konferenz dieses Jahr ergeben.
Das Tanken war für den Kunden sehr einfach, das Laden an der eigenen Wallbox ist es auch – solange der Strom nur vom Netz in den Akku fließt. Wie kann ein bidirektionaler Ladevorgang für den Kunden so einfach, aber gleichzeitig auch so transparent wie möglich gemacht werden?
Die Frage, wie man „einfach“ und „transparent“ gut zusammenbringen kann, ist für mich eine der schwierigsten. Dass ich für einfache Produktstrategien plädiere, die aus der Perspektive des Kunden und seinen Gewohnheiten ergeben, habe ich oben schon deutlich gemacht. Damit wird es den Kunden ermöglicht, die nötige Verhaltensanpassung (z.B. Maximale Ansteckdauer, Angabe von SoC-Bedarf zur Abfahrtszeit) in ihren Alltag zu integrieren. Den Rest, also die Optimierung von Lade- und Entladevorgängen, übernimmt der Aggregator oder Flex-Vermarkter.
Nun zur Transparenz: Algorithmisch gesteuerte Energieflüsse kann man visuell darstellen. Ob die Komplexität der Steuerung Verständnis und Kundenzufriedenheit steigert, ist für mich fraglich. Dazu kommt die Frage, ob ich als Flex-Vermarkter Stromflüsse eins zu eins mit Cent-Beträgen verknüpfen und transparent machen möchte? Da das Geschäftsmodell der Flex-Vermarkter mit einem gewissen Risiko behaftet ist, begründet nicht zuletzt in der Fehlermarge von Strompreisprognosen und Kundenverhalten, muss ich ihm ggf. zugestehen, eine Summenkalkulation vorzunehmen und mich pauschal zu vergüten. Darunter leidet aber natürlich die Transparenz. Aber ist das so schlimm? Ich bin sehr gespannt, ob sich die weit verbreiteten Preiskurven, die heute in vielen Anbieterapps zu sehen sind, auf Dauer halten, oder ob wir uns mehr in Richtung Flatrate bewegen werden. Solange ich als Kunde sicher sein kann, dass meine Batterie immer genug Ladung hat, bin ich sicher auch eher gewillt, die Optimierung abzugeben und auf volle Transparenz zu verzichten.
Das Interview ist Teil der Medienpartnerschaft von electrive mit der „Vehicle2Grid“ vom 02. bis 03. April in Aachen. Die Session Systemintegration von Johanna Bronisch findet am 02. April von 12:55 – 14:55 Uhr statt.



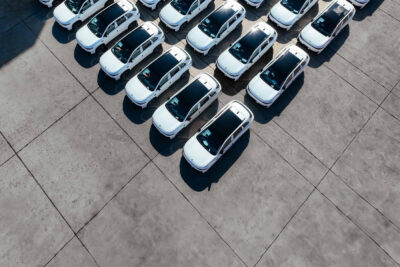


9 Kommentare