Schweiz will 2030 Verkehrsinfrastruktur-Steuer für E-Autos einführen
Die Schweiz will Halter von Elektroautos perspektivisch stärker zur Kasse bitten. Wurde zum 1. Januar 2024 bereits die Befreiung von der Automobilsteuer aufgehoben, bei der Neuwagenkäufer einmalig vier Prozent auf den Importpreis eines Fahrzeugs bezahlen müssen, so soll 2030 eine neue Abgabe hinzukommen, die noch keinen Namen hat, aber der Finanzierung der Straßen dienen soll.
Mit der künftigen Abgabe will der Schweizer Bundesrat, wie die Regierung der Schweiz heißt, Einnahmeausfälle bei der Mineralölsteuer kompensieren, die durch den steigenden Anteil von Elektroautos in dem Land schon entstanden sind bzw. entstehen werden. Denn die größte Einnahmequelle für die Straßeninfrastruktur der Schweiz ist nicht etwa die Maut-Vignette, die Urlaubern bestens bekannt ist, sondern die Mineralölsteuer.
Mit der Mineralölsteuer werden der Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds (NAF) und die Spezialfinanzierung Strassenverkehr bezahlt. Rund die Hälfte der Mineralölsteuer (Grundsteuer) fließt zudem in die allgemeine Bundeskasse. „Heute leisten Halterinnen und Halter von Elektrofahrzeugen keinen entsprechenden Beitrag“, heißt es dazu vom Schweizer Bundesrat, der es an der Zeit sieht, auch E-Fahrzeug-Fahrer zur Kasse zu bitten, wenn auch erst ab 2030.
Da die Straßeninfrastruktur durch jene finanziert werden soll, die sie nutzen, sieht der Bundesrat den entsprechenden Handlungsbedarf. Nun sollen zwei verschiedene Berechnungsmodelle überprüft werden
- Variante nach Fahrleistung: Dabei müsste der Fahrzeughalter eine Abgabe basierend auf den in der Schweiz gefahrenen Kilometern zahlen. Der Tarif pro Kilometer richtet sich nach der Fahrzeugart und dem Fahrzeuggesamtgewicht – je schwerer, desto höher der Tarif. Durchschnittlich beträgt der Tarif für ein Auto 5,4 Rp./km.
- Variante nach Ladestrom: Eine Steuer wird auf den Strom erhoben, der zum Laden des Elektrofahrzeugs in der Schweiz verwendet wird. Besteuert wird die Menge Strom, die zur Ladesäule geht. Die Steuer wird sowohl bei öffentlichen wie privaten Ladestationen erhoben. Der Tarif beträgt 22,8 Rp./kWh und gilt unabhängig von der Fahrzeugart.
Beide Varianten eint, dass ein neues bürokratisches Monstrum geschaffen würde. Bei der ersten Variante nach Fahrleistung müssten technische Möglichkeiten geschaffen werden, die Laufleistung eines Fahrzeugs innerhalb der Schweiz zu erfassen. Bei der zweiten Variante wäre hingegen kniffelig, dass nicht nur öffentliche Ladevorgänge analog zum Tanken eines Verbrenners an der Zapfsäule erfasst werden müssten, sondern auch Ladevorgänge an privaten Ladestationen.
Aktuell ist die Besteuerung von Elektroautos in der Schweiz ziemlich unübersichtlich, schließlich gibt es neben der oben erwähnten Automobilsteuer und einer möglichen künftigen Infrastruktursteuer auch die sogenannte Motorfahrzeugsteuer. Diese wird aber nicht landesweit einheitlich erhoben wie die deutsche Kfz-Steuer, sondern von den unterschiedlichen Kantonen. Manche Kantone gewähren dabei Befreiungen für Elektroautos, manche Rabatte. Perspektivisch sollen die Vergünstigungen für E-Autos aber bei dieser Steuer in den nächsten Jahren auslaufen, damit es zu keinen Einnahmeausfällen kommt.
Unterdessen zeichnet sich aber auch eine neue Regelung ab, die von Vorteil für die Elektromobilität ist: Ziel ist es dabei, Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 Tonnen weitgehend den herkömmlichen Lieferwagen bis 3,5 Tonnen gleichzustellen. Zwar dürfen solche Fahrzeuge seit April 2022 bis zu 750 Kilogramm schwerer sein, um das Mehrgewicht durch die Hochvoltbatterien auszugleichen. Allerdings gelten für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen bislang zusätzliche Anforderungen wie die Fahrtenschreiberpflicht und ein Tempolimit von 80 km/h auf Autobahnen, was nun beides entfallen soll. Auch Schilder mit Lkw-Verbot sollen künftig für Elektro-Transporter bis 4,25 Tonnen nicht mehr gelten.
admin.ch, foodaktuell.ch (E-Nutzfahrzeuge)





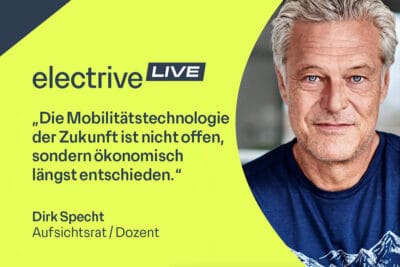
28 Kommentare