Verkehrsministerium legt Entwurf des Masterplans Ladeinfrastruktur 2030 vor
Mit dem Entwurf aus dem Bundesverkehrsministerium (BMV) ist aber die Richtung klar, die Schnieder von der CDU sich vorstellt. Mit dem Masterplan Ladeinfrastruktur 2030 will das Ministerium die Rahmenbedingungen für den weiteren Ausbau schaffen, der auf den vorigen Grundlagen aufbaut – und jetzt auch bei den Elektro-Lkw Ziele konkretisiert und „eine klare Umsetzungsstrategie“ festlegt.
„Der Masterplan Ladeinfrastruktur 2030 ist unser neuer Fahrplan, um die zentrale Voraussetzung für den Umstieg auf die Elektromobilität für alle zu schaffen – und die heißt: Wer laden will, muss laden können!“, sagt Verkehrsminister Schnieder laut der Mitteilung seines Hauses. „Dieses Ziel erreichen wir nur gemeinsam – mit den Ländern und Kommunen, den Unternehmen und Investoren und mit der Aufgeschlossenheit der Bürgerinnen und Bürger. Deshalb haben wir diese Perspektiven auch von Anfang an bei der Erarbeitung des Masterplans einbezogen und werden sie auch in die Umsetzung eng einbinden.“
Mit rund 40 Maßnahmen in fünf zentralen Handlungsfeldern fällt der Masterplan für 2030 etwas kompakter aus als seine Vorgänger. Allerdings sind die Maßnahmen nicht mehr so kleinteilig gehalten, sondern sollen eher allgemein die Rahmenbedingungen schaffen, damit der Ausbau gelingen kann – indem etwa Genehmigungsprozesse vereinfacht, Investitionen beschleunigt und Innovationen gezielt gefördert werden. Also Punkte, die die Ladebranche schon länger fordert.
Blicken wir ein wenig ins Detail. Die fünf Handlungsfelder sind
- Nachfrage und Investitionen stärken
- Umsetzung vereinfachen und beschleunigen
- Wettbewerb und Preistransparenz erhöhen
- Integration ins Stromnetz verbessern
- Nutzerfreundlichkeit und Innovation steigern.
In dem ersten Bereich will das BMV etwa die positive Marktdynamik konsequent flankieren und so die Akzeptanz und das Vertrauen in die Elektromobilität stärken – „auch im Rahmen einer positiven Kommunikation“. „Mit diesem Ziel wird das BMV in seiner Öffentlichkeitsarbeit gezielt über die Elektromobilität informieren und eine entsprechende Kommunikationskampagne entwickeln“, heißt es dort etwa – wobei gerade zuletzt Unions-Politiker mit ihren öffentlichen Äußerungen keine Positiv-Kommunikation für die Elektromobilität betrieben haben.
Weitere Punkte in diesem Bereich betreffen die Ladeinfrastruktur in Mehrparteienhäusern, hier will das BMV Anfang 2026 eine neue Förderung vorstellen, um Ladepunkte in Mehrfamilienhäusern sowie „die Ertüchtigung des Netzanschlusses und der elektrischen Anlagen der Gebäude“ zu fördern. Ähnliches ist für die Depots und Betriebshöfe von E-Lkw und auch E-Bussen geplant. Gerade bei den Bussen soll es die kommende Förderrichtlinie ermöglichen, Ladeinfrastruktur auch unabhängig von Fahrzeugen zu fördern. Aber: Diese Maßnahmen sind „abhängig von der Haushaltslage“ – die Finanzierung ist also noch nicht gesichert.
Nicht jede der Maßnahmen bringt allerdings echte Neuigkeiten: Bei Punkt 6, dem „E-Lkw-Schnellladenetz entlang der Bundesautobahnen“, wird etwa nur bestätigt, dass man die Vorhaben an den 350 unbewirtschaftete und bewirtschaftete AutobahnRastanlagen fortsetzt. Und direkt beim ersten Punkt „Mehr Nachfrage nach Ladestrom durch mehr Elektrofahrzeuge“, wird etwa auf bereits beschlossene Maßnahmen aus dem „Investitionsbooster“ verwiesen – oder auf die geplante Verlängerung der Kfz-Steuerbefreiung für neue E-Autos.
Im Bereich „Umsetzung vereinfachen und beschleunigen“ geht es vor allem um die Regulierung und diverse Vorschriften. So will die Bundesregierung die Vorgaben des Artikels 14 der europäischen Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD) „anwendungs- und bedarfsgerecht“ im Rahmen der vorgesehenen Frist bis April 2026 umsetzen. „Das BMWE wird hierzu einen Vorschlag für eine Änderung des Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetzes (GEIG) vorlegen“, heißt es in dem Entwurf.
Neues „Langzeitkonzept zum Laden an der Autobahn“
Auch hier ist nicht jede Maßnahme grundlegend neu: Es sollen bundeseigene Flächen, auch der Autobahn GmbH des Bundes, für den Bau von öffentlich zugänglichen Ladestationen genutzt werden. Kleine und mittlere Kommunen sollen unterstützt werden, Verordnungen angepasst werden, etwa die Baunutzungsverordnung (BauNVO).
Interessant sind zwei andere Punkte: In der Maßnahme 14 wird ein „Langzeitkonzept zum Laden an der Autobahn“ angekündigt, welches 2026 vorgestellt werden soll. Gemeinsam mit der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur und der Autobahn GmbH will das BMV ein Konzept vorlegen, welches „künftige Anforderungen“ definiere – rund um den Markthochlauf der verschiedenen Fahrzeugklassen bis hin zur „vorausschauenden Dimensionierung von Anschlüssen an das Stromnetz. Und mit der Maßnahme 16 sollen Berichtspflichten und Datenübermittlungen für Ladeinfrastrukturbetreiber vereinfacht werden: Derzeit müssen die Ladepunktbetreiber die In- und Außerbetriebnahme gegenüber der BNetzA anzeigen. Da die AFIR künftig die Übermittlung statischer und dynamischer Daten zu öffentlich zugänglichen Ladepunkten durch die Betreiber an die „Mobilithek“ als Nationalen Zugangspunkt (NAP) vorschreibt, kann dieser diese Anzeigepflicht automatisiert übernehmen. Die Pflicht zu gesonderten Meldung soll daher Ende 2026 entfallen – mit einer Novelle der Ladesäulenverorndung (LSV).
„Heute sind viele Nutzerinnen und Nutzer noch zu oft mit schwer vergleichbaren Ladeangeboten konfrontiert“, schreibt das BMV in dem Entwurf zum dritten Bereich „Wettbewerb und Preistransparenz erhöhen“. Das Ministerium hält an dem Zielbild fest, dass Laden beim Bezahlen und Abrechnen nicht komplizierter sein soll als das Tanken. Hier kommt wieder die AFIR-Vorgabe zur Datenschnittstelle des Nationalen Zugangspunkts für Mobilitätsdaten (NAP) zum Tragen: „Das BMV als Betreiber der Mobilithek als NAP in Deutschland wird einen Zugang bieten, über den die gemäß AFIR bereitgestellten Daten inklusive der Ad-hoc-Preisdaten aller Ladeinfrastrukturbetreiber gebündelt abgerufen werden können. Dadurch entsteht eine Preistransparenzstelle für Ad-hoc-Preise, die die Integration dieser Daten u.a. in Apps und Navigationssysteme für Endverbraucher ermöglicht.“
Bund will AFIR konkretisieren
Zudem will sich die Bundesregierung gegenüber der EU-Kommission einsetzen, „dass die Vorgaben aus Artikel 5 Absatz 3 und Absatz 5 AFIR konkretisiert werden“. Dort wird geregelt, dass die „von Ladepunktbetreiber gegenüber Endnutzern und Mobilitätsdienstleistern (EMP) sowie von EMPs gegenüber Endnutzern berechneten Preise angemessen, einfach und eindeutig vergleichbar, transparent und nichtdiskriminierend sein“ müssen. Diese Formulierung lässt in der Praxis viel Spielraum, der nun klarer definiert werden soll.
Konkreter wird es in Bereich vier, der verbesserten Integration ins Stromnetz. Die in Deutschland höchst komplizierte Lage mit den Antragsverfahren zum Netzanschluss je nach Netzbetreiber sind in der Ladebranche als großes Hemmnis bekannt. Das Verkehrsministerium will im für Schnelllader wichtigen Mittelspannungsbereich die Verfahren standardisieren und vor allem digitalisieren. „Um überregional tätigen Unternehmen den Netzanschluss von Ladeinfrastruktur zu erleichtern, muss der gesamte Anschlussprozess so weit wie möglich digitalisiert und bundesweit standardisiert werden. Netzanschlussbegehren in der Mittelspannung sollen künftig digital gestellt werden können. So bieten digitale Portale die Chance, den Bearbeitungsstatus über die gesamte Antragsstrecke – vom Anschlussbegehren bis zur Inbetriebnahme – digital nachzuverfolgen, was die Transparenz für den Anschlusspetenten erhöht“, heißt es in der Maßnahme 22. In eine ähnliche Richtung gehen die Maßnahmen 23 „Transparenz über und Auskünfte zur Netzanschlusskapazität“ und 24 „Rückmeldefristen und -pflichten zum Status des Netzanschlussbegehrens“. Hier sollen bessere und einfachere Vorgaben sowie Online-Tools die Verfahren beschleunigen, die Planbarkeit verbessern und so die Investitionen in Ladeinfrastruktur vereinfachen. Da mit mehr Ladestationen der Energiebedarf im Stromnetz steigt, ist auch der vorausschauende Netzausbau bzw. die „Weiterentwicklung der Bedarfsprognosen für den Verkehrssektor“ ein wichtiges Thema.
Bidirektionales Laden im Fokus
Und gleich drei Maßnahmen werden dem bidirektionalen Laden gewidmet. Innovative Ansätze sollen hier gefördert werden, da bidirektionale Ladelösungen noch am Anfang des Markteintritts stehen. „Insbesondere im Rahmen der beabsichtigten Förderprogramme in Mehrparteienhäusern sowie bei Depots und Betriebshöfen wird das BMV die Pilotierung bidirektionaler Ladelösungen zur Optimierung des Energieverbrauchs und von Betriebsabläufen unterstützen“, heißt es in der Maßnahme 26. In Maßnahme 27 geht es um die finanziellen Erlöse und bidirektionales Laden als Geschäftsmodell – hier schiebt das BMV den Ball aber vor allem zur Bundesnetzagentur. Die Maßnahme 28 ist im Kern der Gesetzentwurf zur Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes, welches „erhebliche Vereinfachungen für das bidirektionale Laden“ bringen soll.
Mit dem fünften Bereich will das Ministerium „Nutzerfreundlichkeit und Innovation steigern“. Hier fallen die Maßnahmen recht konkret aus: Das in der aktuellen Fassung bis 31.12.2026 befristete Elektromobilitätsgesetz (EmoG), das es Kommunen ermöglicht, den Nutzerinnen und Nutzern von Elektrofahrzeugen umfangreiche Bevorrechtigungen einzuräumen, soll verlängert werden. In der Maßnahme 30 spricht sich das BMV gegen Blockiergebühren in der Nacht aus, will in Maßnahme 31 die Barrierefreiheit stärken (etwa über eine Mindestanzahl an barrierefreien Ladepunkten), in der Maßnahme 32 setzt sich das BMV für eine Reservierungsfunktion für Ladeinfrastruktur aus. In der Verlängerung des EmoG soll das für für mittlere und schwere Nutzfahrzeuge ermöglicht werden, allgemein will die Bundesregierung auf EU-Ebene eine AFIR-Überprüfung anstreben.
Offensive gegen Kabeldiebstahl
Andere Punkte aus der Praxis betreffen die Beschilderung zur Privilegierung von E-Lkw beim Laden und Parken, auch hier soll die EmoG-Novelle und eine Anpassung der StVO Besserung bringen. Zudem soll es eine „Offensive gegen Kabeldiebstahl“ geben, an der auch das Bundesinnenministerium und die Bundesländer beteiligt sind. Und um Kosten zu senken, will die Bundesregierung erreichen, dass der Ersatz beschädigter Kabel keine neuerliche behördliche Eichung der gesamten Ladeeinrichtung erforderlich macht – wie wir berichtet haben, ist das ein großer Zeit- und Kostenfaktor bei der Reparatur „entkabelter“ Standorte.
Eine Maßnahme soll nicht unerwähnt bleiben: Für E-Lkw will der Bunde parallel zu den Schnellladern auch den EInsatz von Batteriewechselsystemen erproben. „Die Nutzung von Batteriewechselsystemen bei E-Lkw verschiedener Hersteller erfordert für die Kompatibilität die Definition technischer Parameter, die herstellerübergreifend austauschbar sind. Diese Definition erfolgt in einer DIN SPEC für ‚tauschbare Wechselbatterien‘ für E-Lkw“, heißt es in der Maßnahme 36. „Auf Basis einer Public Private Key Infrastruktur bis Ende 2025 fertiggestellten DIN SPEC strebt das BMWE an, das „First Industrial Deployment“ (FID) in einem herstellerübergreifenden Demonstrationsvorhaben in den Praxisbetrieb zu überführen und europapolitisch einzubetten (EU-weite Interoperabilität).“





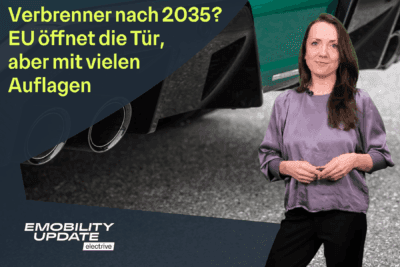
6 Kommentare